Für US-Konzerne sind die Deutschen ein Rätsel
rw-admin | 10/25/2017
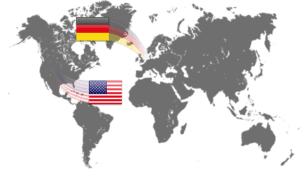
Amazon, General Motors, Google – oft verstehen US-Unternehmen die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Amerika nicht. Deshalb reagieren sie in Krisen meist falsch – mit bösen Folgen.
Amazon hat Glück, dass die Angebote auf der deutschen Homepage des US-Konzerns ein Produkt immer nur mit knappen Stichpunkten beschreiben. Denn die deutsche Sprache ist nicht in jedem Fall die Stärke des Online-Handelsriesen, der hierzulande fast neun Milliarden Dollar Umsatz macht.
„Wir brechen über die Veröffentlichung hinaus keine weiteren Details heraus, daher kann ich hier leider nicht unterstützen“, teilte die Pressestelle kürzlich in einer knappen E-Mail in schlechtem Deutsch mit. Vorausgegangen war die Anfrage, ob die Firma noch mehr zu ihren Zahlen sagen könnte.
Deutschland ist für ausländische Unternehmen ein kompliziertes Land. Die Kultur ist anders, die Sprache schwierig. Gerade Amazon, die ansonsten so erfolgsverwöhnte Firma, merkt das jetzt.
Der Skandal um nicht nur schlecht bezahlte, sondern auch noch schlecht behandelte Leiharbeiter in Deutschland, sorgt für böse Schlagzeilen. Und die Amerikaner taten sich anfangs auffällig schwer, nicht nur sachlich zutreffende, sondern auch emotional beruhigende Antworten auf die drängenden Fragen der Öffentlichkeit zu finden.
Amazon aber ist kein Einzelfall. Ausländische Konzerne, gerade die erfolgsverwöhnten, reagieren in Krisensituationen meist zu spät. Und dann auch noch falsch. Ist das Presseecho negativ, fühlen sich die Bosse in Übersee und deren Kommunikatoren oft böswillig falsch verstanden.
Deutschland wird zum Reputationsrisiko
Der Grund sind kulturelle Unterschiede, die unterschätzt werden. Erst harte Krisen machen den Wirtschaftsriesen klar, dass fremde Märkte besonders im Internetzeitalter mehr als nur Absatzgebiete für die eigenen Waren sind. Sie sind im Krisenfall auch ein Reputationsrisiko. Damit geht man besser sorgfältig um.
Google wird das demnächst merken. Eric Schmidt, der Chairman des Konzerns, hatte im vergangenen Jahr die Europäer provoziert. Stolz gab er zum Besten, dass sich sein Unternehmen eine Struktur überlegt habe, mit der es in Europa kaum Steuern zahlen müsse. „Man nennt dies Kapitalismus“, protze Schmidt.
In den USA mag so etwas ankommen. In Deutschland aber erreichte Schmidt das Gegenteil: „Der Google-Chef hat uns den Finger gezeigt, und ich nehme die Herausforderung an“, droht Michael Sell, Leiter der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium. Mit Eile treibt jetzt Wolfgang Schäuble die Suche nach einer gesetzlichen Lösung des Problems über internationale Vereinbarungen heran. Die Zeiten, in denen Google zwar 54 Prozent seiner Gewinne im Ausland macht, darauf aber nur drei Prozent Steuern zahlt, sind gezählt.
Das Hauptproblem sind die unterschiedlichen Kulturen zwischen dem Mutterland und dem wichtigsten Absatzmarkt in Europa. „Rassendiskriminierung oder Sexismusvorwürfe gegen Unternehmen werden in der amerikanischen Öffentlichkeit und den US-Medien schwer abgestraft“, sagte Frank Roselieb.
Anders sei es dagegen mit Berichten über die Ausbeutung von Arbeitnehmern oder menschenverachtende Arbeitsbedingungen, sagt der Chef des Kieler Instituts für Krisenforschung. Solche Berichte, die in Europa für viel Ärger sorgen, blieben in den Vereinigten Staaten dagegen in der Regel ohne Folgen.
Facebook verschätzt sich
Bestes Beispiel sind die schlimmen Zustände beim Apple-Zulieferer Foxconn in China. Hierzulande erntete das ansonsten so beliebte Unternehmen einen wahren Shitstorm, als die Arbeitsbedingungen dort bekannt wurden. In den USA jedoch verfängt das Thema kaum.
Das soziale Netzwerk Facebook musste die so verschiedenen Befindlichkeiten auf die harte Tour lernen. Stolz präsentierte die Firma in Deutschland im Jahr 2011 ihre Gesichtserkennung für Fotos im Internet. Auf Bildern, die in das Netzwerk geladen wurden, sollten Freunde automatisch erkannt werden.
Facebook dachte, es würde für die Kunden ein Riesenspaß werden. Für das Online-Netzwerk jedenfalls wurde es ein Riesenärger. Datenschützer und Politiker stürzten sich auf den Konzern. In Deutschland fühlte man sich an George Orwells Buch 1984 vom Überwachungsstaat erinnert und damit auch an die DDR.
Ein gutes Kommunikationsteam in Deutschland hätte die Amerikaner vor dieser Falle warnen können. Inzwischen weiß man das. Facebook beschäftigt deshalb jetzt in Berlin einen Cheflobbyisten.
Unterschiedliche Kulturen machen sich allerdings nicht nur beim Problembewusstsein bemerkbar. Große Unternehmen werden auf anderen Kontinenten schlicht anders geführt als in Deutschland. Und das hat Folgen.
„In US-Konzernen, erst recht aber in asiatischen Firmen, gelten fast militärische Hierarchien“, erzählt ein Berater. „Wenn der Vorstandschef dort einen Befehl ausgibt, wird der bis zum letzten Mann runter umgesetzt.“ In Deutschland ist das anders. Und Pressestellen amerikanischer Konzerne dürfen hier außerdem oft nur zu Produktthemen reden. Unternehmenszahlen, Krisen, gar Skandale, werden aus der Zentrale in den USA heraus betreut.
Zeitverschiebung bringt Probleme
In guten Zeiten mag diese Strategie funktionieren; im Krisenfall aber wird sie zu einem ein Problem. Wenn Medien am Abend im deutschen Fernsehen einen Skandal wie bei Amazons Leiharbeitern aufdecken, dann erfährt die Firmenleitung in Seattle vermutlich erst gegen 8 Uhr am nächsten Tag davon.
Bei einem Zeitunterschied von neun Stunden ist es da in Deutschland schon 17 Uhr. Bis Amazon in den USA eine passende Reaktion erarbeitet hat, ist es spät. Die Firmen laufen der Entwicklung hinterher.
Deutsche Mitarbeiter wissen um die strukturellen Probleme, nur ändern können sie an den starren Abläufen meist nichts. „Wenn mich ein deutscher Journalist anruft, muss die Anfrage zunächst ins Englische übersetzt werden“, erzählt ein ranghoher Mitarbeiter eines US-Konzerns. Dann muss er in der Zentrale einen passenden Ansprechpartner finden und diesen davon überzeugen, dass die Anfrage aus dem kleinen Deutschland tatsächlich wichtig ist.
Weil in den USA unternehmensrelevante Aussagen immer auch zu teuren Schadensersatzklagen von Aktionären führen können, wird der Amerikaner im Zweifelsfall noch einen Juristen einschalten. Seine Antwort muss dann noch ins Deutsche übersetzt werden. „Wenn sie beim Journalisten als E-Mail ankommt, ist die Zeitung längst gedruckt“, klagt der Pressesprecher. Vertrauen kommt so nicht auf.
Kommunikation rückt in den Vorstand
Noch schlimmer wird es, wenn die Konzernmutter in den USA und die deutsche Tochter miteinander im Clinch liegen. General Motors und Opel sind dafür ein gutes Beispiel. In der größten Krise übernahmen die Beschäftigten des deutschen Autobauers die Kommunikation. GM, die scheinbar so grausame Mutter in den USA, verlor den Einfluss über ihr Unternehmen hier und sah damit schlecht aus.
Es wird Jahre dauern, das zu ändern. „Kommunikation wird zunehmend zur Vorstandsaufgabe“, glaubt Alexander Geiser, Deutschland-Chef der Kommunikationsberatung Hering Schuppener. „Das Verständnis dafür in den Chefetagen wächst. Und auf Dauer führt das zu einer Professionalisierung von Kommunikationsprozessen.“
Die meisten Unternehmen lernen das Geschäft im Ausland nur durch schlechte Erfahrungen. Microsoft etwa. Seit Jahren hat der Konzern eine Pressestelle hier. Doch nach den Wettbewerbsverfahren der EU-Kommission, war das Image des Software-Giganten angekratzt. Der Konzern baute deshalb die Kommunikation stark aus und engagiert sich seitdem auch sozial.
Deutschland steht in der Zentrale in Redmond hoch im Kurs. Konzernchef Steve Ballmer ist regelmäßig hier. Und deutsche Manager wiederum werden regelmäßig auf internationale Posten befördert. Das hilft auch dem internationalen Verständnis.
