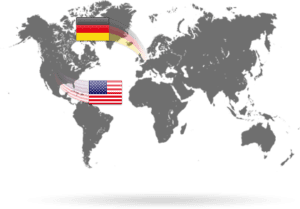So ticken amerikanische Chefs
rw-admin | 06/05/2018
Nicht dem Boss widersprechen, Vorsicht mit schlüpfrigen Witzen, nie maulen bei Überstunden: Trotz vieler Gemeinsamkeiten gibt es eine kulturelle Kluft, die transatlantische Karrieren empfindlich stören kann, sagt Berater Ron Gorlick. Er hat Tipps gesammelt, die Deutschen helfen, dumme Fehler zu vermeiden.
Vor etwas mehr als 13 Jahren kam ich aus den USA nach Deutschland, um meinen ersten Vollzeitjob in einer mittelgroßen deutschen Unternehmensberatung anzutreten. An die erste Arbeitssitzung in der neuen Firma erinnere ich mich gut: Der Chef und Eigentümer erläuterte, das Unternehmen habe alles dafür getan, mehr weibliche Berater zu verpflichten. Leider bislang ohne durchschlagenden Erfolg.
Meine Kollegin Andrea entgegnete: „Ich muss widersprechen. Wir haben bei Weitem nicht alles getan, was wir konnten.“ Anschließend zählte sie auf, was die Firma alles versäumt hatte, um mehr Frauen zu verpflichten.
„Schade“, dachte ich, „eine nette Kollegin, aber nun wird sie wohl entlassen.“ In den USA steht man nicht einfach auf und widerspricht seinem Vorgesetzten in aller Öffentlichkeit. Wer das tut, dessen Tage im Unternehmen sind schnell gezählt.
Ich sollte mich noch wundern, das Gegenteil war der Fall. Meine Kollegin wurde zwei Monate später befördert.
„Für viele Amerikaner ist respektvoller Widerspruch ein großer Schritt“
Wahrscheinlich hatten deutsche Expatriates in meinem Heimatland USA für sie ähnlich erstaunliche Erlebnisse. Mich interessierte, wie diese aussahen. Neben meinen persönlichen beruflichen Erfahrungen in beiden Kulturkreisen griff ich auf eine Studie zurück, die ich bereits im Jahr 2003 durchgeführt habe. Zudem führte ich in den vergangenen Wochen ausführliche Interviews mit 16 hochrangigen Führungskräften, 3 Amerikanern und 13 Deutschen.
Die Interviewpartner repräsentieren eine breite Palette an Branchen, große und kleine Unternehmen, arbeiten als Fachgebietsleiter, Geschäftsführer oder sind beratend tätig. Sie alle besitzen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Arbeitsstilen der beiden Kulturen.
Meine Gesprächspartner konnten viele Erfahrungen liefern, die Deutschen in den USA helfen. Ich ermunterte sie, Ratschläge für Deutsche zu formulieren, die in die USA entsandt werden.
Hätte meine eingangs erwähnte deutsche Kollegin ihren amerikanischen Chef auf die gleiche Weise kritisiert, wäre das ihrer Karriere sicher nicht dienlich gewesen. Es bestehen offenbar signifikante Unterschiede in der Art, Autorität auszuüben und zu akzeptieren. Von deutschen Expatriates wird erwartet, dass sie sich anpassen. Ralf Drews, Deutscher und President und CEO von Dräger Safety für Nordamerika, erläutert: „Meine deutschen Kollegen behandelten mich mit schonungsloser Offenheit. Ich animiere auch meine US-Mitarbeiter dazu, meine Meinung infrage zu stellen, mich herauszufordern. Aber für viele Amerikaner ist respektvoller Widerspruch bereits ein großer Schritt. Einige sind sehr mutig, andere weniger.“
Alle duzen sich – aber zum Lunch geht jeder nur mit seinesgleich
Harald Stock, Deutscher und CEO des Arzneimittelkonzerns Grünenthal Group, hat lange in den USA gearbeitet. Er sagt: „Wenn die ranghöchste Person im Raum ein Statement abgibt oder eine Entscheidung fällt, wird darüber nicht diskutiert. In Deutschland werden Sie höchstwahrscheinlich einige höfliche Gegenargumente hören.“
Harald Rang, Deutscher und Group Vice President bei BASF, kehrte 2006 nach Deutschland zurück, nachdem er als Expatriate in die USA entsandt worden war. Seiner Ansicht nach gibt es in den USA ein größeres Bewusstsein für Hierarchien als in Deutschland. Dabei sieht es zunächst aus, als sei es genau umgekehrt. In Deutschland zeigen sich Hierarchien durch Symbole, die in den USA keine große Rolle spielen, außer auf den obersten Führungsetagen. Dazu gehören ein Firmenwagen und ein eigenes Sekretariat.
Bekannt ist, dass Amerikaner sich fast durchweg mit dem Vornamen ansprechen. Doch was bewirkt das? Stefan Sobottka, Deutscher und Bereichsmanager bei Gillette, verbrachte mehrere Jahre in Boston. Er stellt dazu fest: „Es vermindert das Gefühl hierarchisch bedingter Distanz oder kaschiert sie. In den USA fühlt man sich einander näher, obwohl die Hierarchie immer noch da ist.“
Allerdings fördert das Anreden mit dem Vornamen nicht zwingend den Gedankenaustausch mit anderen Hierarchieebenen. Chris Martin, Amerikaner, Führungskraft bei Bosch, der schon zum zweiten Mal nach Deutschland entsandt wurde, sagt: „Anders als in den USA gehen in Deutschland auch Führungskräfte verschiedener Ebenen miteinander mittagessen.“
Wer lang diskutiert, dem fehlt es wohl an Leadership
Eng mit dem Leben von Hierarchien hängt die Frage zusammen, wer im Unternehmen an Entscheidungen beteiligt wird. Franz Bosshard stand von 2002 bis 2008 an der Spitze von BSH Bosch and Siemens Home Appliances Corporation in den USA. Er erläutert: „In den USA trifft ein Verantwortlicher die Entscheidung und ist dann auch für alle Konsequenzen verantwortlich.“ Bosch-Manager Martin ergänzt: „Eine derartige Anordnung von oben funktioniert in Deutschland nicht. In den USA dagegen müssen Sie Ihrem Anliegen Nachdruck verleihen. Eine US-Führungskraft kann sagen: Hier ist meine Entscheidung, zu diesem Zeitpunkt brauche ich Ihre Ergebnisse, bitte richten Sie Ihre Prioritäten danach aus.“
Aus diesen Unterschieden lassen sich verschiedene Ratschläge ableiten: Kollegen und Vorgesetzte in den USA empfinden es als Mangel an Leadership, wenn Sie zu sehr darauf aus sind, Zustimmung zu erlangen, und Ihre Verhandlungen sich in die Länge ziehen. Diskutieren Sie, aber tun Sie es schnell. Finden Sie das richtige Gleichgewicht. Sie müssen Ihr Verhalten nicht radikal ändern, aber verleihen Sie Ihrem Anliegen mehr Nachdruck als gewohnt. Deutsche Manager sollten in den USA darauf achten, dass sie die Kontrolle über den Prozess behalten. Oft denken sie, sie dürften eine Entscheidung nicht allein fällen. Konzentrieren Sie sich auf die kritischen Themen. Erlauben Sie den Mitarbeitern, Input zu geben, und fällen Sie dann zügig Ihre Entscheidung.
Lust auf Risiko: „In den USA schießt man oft, ohne zu zielen“
Unterschiede arbeiteten die Gesprächspartner bei Arbeitsstil und -geschwindigkeit heraus: Matthias Kempf, ein Deutscher, arbeitet als Director Group Development & Training Region Americas bei der Adidas Group in Boston. Seiner Meinung nach „fallen Entscheidungen in den USA schneller. Die Verantwortlichen glauben, sie könnten später noch nachbessern. Sie haben nicht die Geduld, alles ausführlich zu diskutieren.“
Den deutschen Kollegen eilt der Ruf voraus, dass die Zusammenarbeit mit ihnen viel Zeit in Anspruch nimmt. Sie sind dafür berüchtigt, jeden Schritt von Anfang an klar zu definieren und dann über alles endlos zu debattieren. „In den USA schießt man oft, ohne zu zielen. Das hat Vorteile: Dinge werden erledigt. US-Manager gehen kalkulierte Risiken ein. Deutsche wollen immer eine Sicherheit von 120 Prozent, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ist diese dann gefallen, hinterfragen Führungskräfte sie nicht mehr. Sie würden ihr Gesicht verlieren, wenn sie einen Fehler zugeben müssten“, beschreibt Grünenthal-Manager Stock die Unterschiede.
Nikolaus Marbach, Deutscher und Senior Manager bei Accenture, hat viele Jahre in Kanada und den Vereinigten Staaten gearbeitet. Seine Erfahrung besagt: Bei den Deutschen muss ein Plan komplett stehen, bevor sie anfangen ihn umzusetzen, den Amerikanern genügen 80 Prozent.
Deutsche Vorsicht und Risikofreude können sich gut ergänzen
Bosch-Manager Bosshard hält die Amerikaner daher für pragmatischer. Sie arbeiten gern mit wenig detaillierten Vorgaben. Zum Beispiel testen sie einen Markt, bevor sie in die Produktion gehen. „Manchmal ist es besser, zu 80 Prozent richtig zu liegen und in den Markt zu gehen, als auf die 100 Prozent hinzuarbeiten und dann erst zwei Jahre später in den Markt zu kommen“, lautet seine Beurteilung dieser Strategie.
Nach Ansicht von Martin Madaus hängt die Bereitschaft, größere Risiken einzugehen, mit dem höheren Druck zusammen, Resultate präsentieren zu müssen. Madaus ist CEO bei der Millipore Corporation in Boston. Er wuchs in Deutschland auf, zog für seinen vorherigen Job in die USA und nahm die US-Staatsbürgerschaft an. „In den Vereinigten Staaten müssen Sie handeln und Ihr Business vergrößern. Ihre Ergebnisse sind transparenter, Sie sind unmittelbarer in der Verantwortung und denken eher in kurzfristigen Zielen.“
Deutsche Manager, die in den USA tätig sind, sollten sich dieses Unterschieds im Denken und Handeln bewusst sein. Am besten sei es, einen Mittelweg zu suchen, der die Stärken beider Denkweisen kombiniert, sagen fast alle Gesprächspartner. Deutsche müssen die US-Vorgehensweise verstehen. Sie könnten lernen, Fehler zu machen und Risiken positiver zu sehen beziehungsweise sie nicht so ernst zu nehmen. Auf der anderen Seite könnten die Amerikaner von der deutschen Tugend, organisiert zu planen, profitieren.
Das Ziel ist das Ziel
Deutsche arbeiten viel an dem Weg, der bei einem Vorhaben zum Ziel führt. Amerikaner konzentrieren sich relativ schnell auf das Ziel selbst. Der Deutsche Andreas Schröder, Manager bei Gillette, erklärt den Hintergrund so: „Amerikaner leben in einer Kultur der Bewegung; sie bewegen sich nach dem Prinzip Versuch und Irrtum. Sie erreichen das Ziel oft genauso schnell wie die Deutschen, aber die Amerikaner haben nicht zusammengesessen und das Projekt in der Theorie diskutiert.“
Jan Snodgrass, President von Hanro USA, ist Deutsch-Amerikaner und arbeitete 15 Jahre in Deutschland, bevor er 2008 wieder in die USA zurückkehrte. Er beschreibt, worauf Mitarbeiter sich bei ihrer Arbeit konzentrieren: „In Deutschland haben Sie eine Stellenbeschreibung. Innerhalb dieser Aufgabe gibt man sein Bestes. In den USA dagegen ist nur das Ergebnis relevant. Wie ein Mitarbeiter es erreicht, ist sein Problem.“ Meine Gesprächspartner beschreiben, dass eine Art kollektiver Druck entsteht. Jeder muss Ergebnisse erreichen, obwohl er nicht alle damit verbundenen Einflüsse unter Kontrolle hat. Das System ist gnadenlos.
Für Sommerurlauber haben Amerikaner vor allem Unverständnis übrig
Mit dem höheren Druck und den schnelleren Entscheidungen gehen unterschiedliche Erwartungen an das Verhalten der Führungskräfte und der Mitarbeiter einher. „In den USA scheint alles immer dringend zu sein, während in Deutschland eine eher entspannte Einstellung vorherrscht“, sagt Snodgrass. In Europa kann man die Dinge auch einmal liegen lassen. Das fängt schon damit an, dass deutsche Manager mit Abwesenheitsbenachrichtigungen arbeiten. In den USA dagegen hat eine Führungskraft verfügbar zu sein. So fragen die Amerikaner zum Beispiel immer erstaunt nach, warum die Verkaufszahlen im August in Europa so stark heruntergehen und warum im Sommer nur noch so wenige Memos beantwortet werden.
Amerikanische Führungskräfte bleiben auch in den Ferien auf dem Laufenden. So ist es unüblich, zwei Wochen am Stück Urlaub zu machen. Wer dies doch tut, spricht besser nicht darüber. Einige Angestellte werden noch nicht einmal bezahlt, wenn sie krank sind. Das zeigt, wie die Mitarbeiter und Manager ihre Beziehung zum Arbeitgeber definieren und wie sicher sie sich ihres Arbeitsplatzes fühlen. Die Empfehlung, die sich daraus für Expatriates in den USA ableiten lässt, ist klar: Es gilt in jedem Fall sensibel zu sein und nicht ständig über Urlaubspläne zu sprechen. Wenn Sie einen Abwesenheitsagenten für Ihre E-Mails einrichten, erwähnen Sie möglichst nicht, dass Sie im Urlaub sind.
Political Correctness: Zotenreißer sollten ihr Mundwerk hüten
Eine weitere Besonderheit im Arbeitsumfeld amerikanischer Unternehmen kennen wir unter den Begriffen Diskriminierung und politische Korrektheit. Deutsche Expatriates sollten besonders sensibel sein, wie Millipore-CEO Madaus empfiehlt.
„Themen, die mit Diversität in Bezug auf African Americans, Immigranten oder Frauen zu tun haben, werden alle von spezialisierten Anwälten vertreten. Ich habe viele Leute gesehen, die massiven Ärger bekommen haben.“
Die Arbeitsatmosphäre in US-Firmen ist in der Regel eher entspannt und der Umgangston leger. So lassen sich deutsche Manager leicht zu Äußerungen verleiten, die ihnen später, in formellen Kontexten wie Personalgesprächen, zum Verhängnis werden. Besonders das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist oft eine böse Falle. Ein zotiger Witz, der in Deutschland durchgeht, kann in den USA als Belästigung ausgelegt werden.
Darauf können sehr extreme Reaktionen bis hin zum Gerichtsverfahren folgen. Es ist sinnvoll, im Rahmen der Personalführung eine gewisse Distanz zu seinen Mitarbeitern zu wahren. Dort gilt es eine allzu persönliche Ansprache zu meiden. Jan Snodgrass sagt: „Sie sollten sich davor hüten, Angriffsflächen für Klagen zu bieten.“
US-Arbeitsethos: Weniger diszipliniert und dafür länger
Wichtig war für meine Interviewpartner auch das Thema Produktivität. Wenn ein Deutscher zur Arbeit kommt, dann arbeitet er. Da gibt es kein Geplauder, und es werden keine persönlichen Dinge erledigt. Die Zeit, die man in Deutschland im Büro verbringt, ist limitiert, die meisten gehen nach der regulären Arbeitszeit nach Hause. In den USA dagegen arbeiten die Menschen weniger intensiv, dafür länger.
Chris Martin sagt: „Das hohe Produktivitätsniveau in Deutschland beeindruckt mich. In den USA vermischen wir Privates und Arbeit stärker. Da wir länger im Büro sitzen, wundert sich auch niemand, wenn Sie zwischendurch ein privates Gespräch führen oder mitten am Tag die Kinder von der Schule abholen.“
Harald Stock ergänzt: „In Deutschland gereicht es Managern zum Nachteil, wenn sie sich verabschieden, um das Fußballspiel ihrer Tochter anzuschauen. In den USA ist das völlig akzeptabel.“ Deutsche Expatriates in den USA sollten sich darauf einstellen, dass Arbeit mehr Raum in ihrem Leben einnimmt. Sie müssen ihre Arbeit stärker mit ihrem Privatleben verzahnen und vor allem Verständnis dafür haben, wenn ihre US-Mitarbeiter sich dementsprechend verhalten.
Es wird erwartet, dass Sie einen Blackberry benutzen und auch am Wochenende auf E-Mails antworten. Flexibilität wird vorausgesetzt und geschätzt. Sie verbringen zwei, drei Stunden mit Ihrer Familie und kehren abends an Ihren Computer zurück.
„Amerikanische Führungskräfte feiern auch kleine Erfolge“
Amerikaner bevorzugen indirekte, eher subtile Kommunikation. Silke Skrzipietz, Head of HR Regions bei Dräger Medical in Lübeck, beschreibt das so: „Die Menschen haben eine sehr freundliche Art zu sagen, was sie wollen. Sie sind höflich, nutzen ein blumiges, sanftes Vokabular. Botschaften werden wie Geschenke verpackt.“
So kommt es häufig zu Missverständnissen zwischen Deutschen und Amerikanern. Als Manager in den USA denken Sie oft, Ihr Team stimme mit Ihnen überein, was aber nicht der Fall ist. Ralf Drews von Dräger Safety erläutert, wozu das führen kann: „Wenn ein Amerikaner vorschlägt, vielleicht sollten wir x, y oder z ausprobieren, heißt das im Grunde: Wir machen es. Das verstehen Deutsche nicht. Sie denken, Amerikaner hätten eine Hidden Agenda. Umgekehrt finden Amerikaner Deutsche oft sehr rüde.“
Dies führt dazu, dass auch die Art, Feedback zu geben, sich unterscheidet. Deutsche sind mit Lob eher zurückhaltend. Das steht in starkem Kontast zur Neigung der Amerikaner, Superlative zu benutzen und Mitarbeiter ständig anzufeuern. Adidas-Manager Kempf beschreibt dies so: „Amerikanische Führungskräfte konzentrieren sich mehr auf das Positive. Sie feiern zum Beispiel auch kleine Erfolge.“
Ist etwas schlecht gelaufen, gibt es „Raum für Verbesserungen“
Accenture-Mann Marbach hält das Zielemanagement und die Karriereplanung in den USA für stärker professionalisiert als in Deutschland. Management by Objectives ist weitverbreitet. Dennoch bekommen Manager nicht zwingend negatives Feedback, wenn sie ihre Ziele verfehlen. „Statt ’schlechter‘ Performance spricht man von ‚Raum für Verbesserungen'“, erläutert Marbach. In Deutschland schöpfe man dagegen die gesamte Skala von Bewertungen aus. Eine rein positive Bewertung nehme keiner ernst.
Für einen Expatriate gilt es die richtige Balance zu finden. Der deutsche Ansatz, sehr direkt zu sein, kann gut funktionieren. Er hat den Vorteil, dass die Leute wissen, wo sie stehen. Achten Sie darauf, Ihr Feedback richtig zu verpacken. Es sollte nicht zu hart oder negativ klingen. Kommunizieren Sie Schwächen auf eine nette Art. Umgekehrt gilt: Deutsche Manager sollten sehr genau hinhören, wenn sie Feedback von ihrem amerikanischen Chef bekommen. Die Kritik steht zwischen den Zeilen.
Der Spiegel, SPIEGEL ONLINE INTERNATIONAL; Ron Gorlick